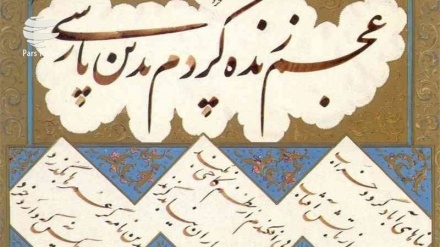Iranisches Kunsthandwerk (Teil 7 - Töpferei)
Nachdem wir Ihnen, liebe Freunde, einen kleinen Überblick über die Geschichte des iranischen Töpfereihandwerkes gegeben haben, wollen wir nun dieses Kunsthandwerk auch aus einem anderen Blickwinkel betrachten.
Die Qualität eines Kunsthandwerkes hängt natürlich an erster Stelle von der Kreativität und dem Geschmack des Künstlers ab. Aber die Verbesserung der Herstellungsmethoden und Hilfsmittel kommt natürlich ebenso der Qualität der Erzeugnisse zugute. Dies gilt auch für die iranische Töpferei. Circa ab dem 4. Jahrtausend vor Christus wurde auf dem iranischen Hochland eine Töpferscheibe entwickelt, mit er sich bessere Tongefäße herstellen ließ, wie die Funde im zentraliranischen prähistorischem Tappe „Sialk“ (bei Kaschan) zeigen.
Natürlich resultierte auch aus der Weiterentwicklung der Brennöfen – und Methodik schönere und solidere Tonware. Zur Verbesserung der Färbung von Tongefäßen, ließ man sich ebenfalls etwas einfallen. Es wurden beim zweiten Brenndurchgang Farbstoffe zugefügt. Dabei vermengte man oft Eisenoxidpulver mit Wasser und Magnesiumoxid.
Nun sollten wir aber auch kurz das Material besprechen, aus dem der Töpfer seine Werke anfertigt, nämlich Ton oder Lehm.
Das Rohmaterial für die Keramik finden wir in zweierlei Form in der Natur vor. Man spricht von primärer Tonerde, wenn sie sich noch beim Muttergestein befindet und nicht durch Wind oder Wasser verlagert wurde. Diese Tonerde hat wenige Beimischungen. Unterdessen hat sich sekundäre Tonerde mit organischen Stoffen und verschiedenen Oxiden vermischt, weil sie durch Oberflächenwasser oder Wind abgetragen wurde. Dieser Ton ist nicht so rein wie die erste Art, dafür aber klebriger.
Das in der Töpferei verwendete Rohmaterial ist formbar oder nicht formbar. Nicht formbar sind zum Beispiel Feuerstein und Talk oder Silicium Dioxid. Manches Rohmaterial , wie der Feuerstein, hat einen hohen Schmelzpunkt und eine gute chemische Beständigkeit. Für das Tongefäß selber oder seine Glasur werden auch Feldspat, Natriumoxide, Kalium, Bor und Barium verwendet.
Es werden verschiedene Werkzeuge und Gegenstände für Töpferei und Keramik benötigt und zwar zum Zerkleinern von Steinmaterial und zum Zermahlen, und Vermischen und Trocknen sowie Siebe. Benötigt werden natürlich auch die Töpferscheibe und kleine Werkzeuge für die Bearbeitung der Töpferware auf der Scheibe und natürlich ein Brennofen.
Der Arbeitsvorgang lässt sich in vier Stufen einteilen: Vorbereitung der Ton-Masse, deren Formung, dann die Verzierung und schließlich das Brennen. Jeder Abschnitt erfordert viel Geduld und Sorgfalt. Einer erfahrener Töpfer gibt aber auch bei der Wahl des Brennofens gut Acht, denn dieser ist das Herz seiner Keramik-Werkstatt und die wichtigste Investition.
Einige wichtige Punkte bei der Wahl eines Brennofens sind heute unter anderem Art und Menge und gewünschte Qualität der Tonware, die man brennen will, Brenntemperatur und Brenndauer sowie Standort in der Werkstatt.
Früher wurden Tongefäße fast überall im Iran für den täglichen Gebrauch oder als Ziergegenstand angefertigt. Heute ist das anders. Nur noch einige bestimmte Orte sind Töpfereizentren und der Gebrauch im Alltag ist erheblich zurückgegangen, auch wenn die oft sehr hübschen Erzeugnisse immer noch beliebt sind. Eines der wichtigen iranischen Töpfereizentren ist Lalejin. Lalejin liegt in Westiran, in der Provinz Hamadan, 20 km nördlich vom Provinzzentrum Hamadan. Lalejin ist nicht nur im Iran sondern im ganzen Mittleren Osten für seine Töpferware und Keramik bekannt. 80 Prozent der Bevölkerung dieser Stadt lebt von diesem Kunsthandwerk. Es steht vor Ort eine gute Tonerde zur Verfügung. Die Keramikware aus Lalejin wird auch in viele Länder exportiert. Es handelt sich sowohl um Gebrauchs- als auch Dekorgegenstände. Die Gefäße kommen oft unglasiert und unbemalt auf den Markt oder die Glasur ist einfarbig, nämlich hell oder dunkelblau, in Henna-Farbe, Gelb, Türkis oder in Braun. Die meisten Tongefäße aus Lalijin werden auf der Töpferscheibe hergestellt.
Doch auch die Wüstenstadt Meybod in der zentraliranischen Provinz Yazd ist noch ein Töpfereizentrum. Hier wird mit weißer Tonerde getöpfert. Nach Formung des Gefäßes wird die Oberfläche noch einmal mit einer wässrigen Kaolin-Schicht versehen und dann in verschiedenen Farben bemalt. Der Abschluss bildet eine farblose Glasur. Eines der häufigsten Motive auf diesen Gefäßen aus Meybod ist das Chorschid-Chanom –Motiv –. Chorschid-Chanom – wörtlich „Frau Sonne“ ist eine Sonne mit einem ausdrucksvollen Frauengesicht – Weitere Motive für die Tonware aus Meybod sind Blumen, Vögel und Fische. Das Blumen-Vogel Motiv aus Meybod unterscheidet sich von dem aus anderen Gegenden Irans.
Außer Lalejin und Meybod lässt sich auch noch auf andere Orte hinweisen, die für ihre Töpferware bekannt sind wie: Shahwar in der Nähe von Minab (Hormozgan am Persischen Golf ) , Mand bei Gonabad im nordöstlichen Razavi Chorasan, Zanuz in der Nähe von Täbris (Ost-Aserbaidschan), die nördlichen Provinzen am Kaspischen Meer Mazanderan und Gilan, Semnan östlich von Teheran, Saveh und Qum südlich von Teheran, aber auch Shahresa in der Provinz Isfahan. Je nach Herkunftsort ist die Art und Verzierung verschieden. Zum Beispiel werden nur in Qum die bekannten türkisfarbenen Tonperlen angefertigt. Hierbei werden rohe und getrocknete Tonperlen in eine alkalische Glasur die Kupferoxid enthält eingetaucht und so entsteht die türkisblaue Farbe dieser Perlen.
Ein Gebiet, in dem die Töpferei auf eine lange Geschichte zurückblickt ist die Provinz Sistan Balutschistan in Südostiran. Die Geschichte der Töpferei reicht hier bis in die Altsteinzeit und prähistorische Zeiten zurück.
56 km südlich von Zabol liegen am Rand der Straße nach Zahedan die Reste einer historischen Stadt namens Schahr-e Suchte (die verbrannte Stadt). Sie ist vor circa 6000 Jahren noch bewohnt gewesen. Schahr-e Suche galt einst als Zentrum einer Hochkultur.
Archäologische Funde an diesem antiken Ort zeigen, dass dort 3200 vor Christus weitgehend die Töpferei üblich war.
Es gibt in der Provinz Sistan Balutschistan ein Dorf, das für seine besondere Tonware, die einen Hauch von Antike bewahrt hat, bekannt wurde. Dieses Dorf heißt Kalpuregan und gehört zum Landkreis Saravan. Die Balutschen-Frauen fertigen dort ohne Töpferscheibe eine besondere Art von Tongefäßen an, und zwar nicht mit der Töpferscheibe, sondern durch die Wulsttechnik, die schon 4 bis 6 Tausend Jahre betrieben wird und bei der Tonwulste übereinander gelegt werden. Die Tongefäße aus Kalpuregan werden nur von den Frauen angefertigt und schwere Arbeiten wie die Herbeischaffung der Tonerde und ihre Vorbereitung ist Sache der Männer. Eine Glasur wird auch nicht verwendet. Die Gefäße werden mit geometrischen Mustern bestehend aus Punkten und Kreisen und geraden Linien verziert. Anschließend werden sie noch gefärbt und zwar wird die dabei verwendete braune oder schwarze Farbe durch Zerreiben eines Gesteines, das sich Sang-e Tituk- nennt, und Vermischung dieses Steinpulvers mit Wasser gewonnen. Sang-e Tituk enthält unter anderem Magnesiumoxid und dreiwertiges Eisenoxid.
Im nächsten Teil wollen wir speziell über wichtigen Zweige der Anfertigung von Tonwaren, nämlich die die traditionelle Keramik und Kachelanfertigung.